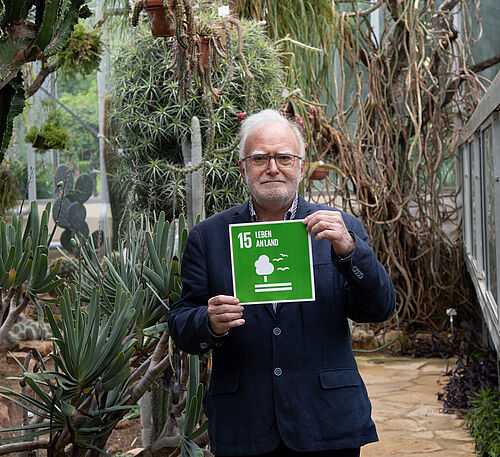
Die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) wurden 2015 von den United Nations verfasst und formulieren die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung für alle Länder der Erde bis 2030.
Mit unserem SDG-Botschaftsprogramm wollen wir euch zeigen, der sich an der TU Braunschweig ganz konkret und tagtäglich für diese Ziele einsetzt. Heute möchten wir euch Prof. Dr. Dietmar Brandes vorstellen, er arbeitet am Institut für Pflanzenbiologie und ist Vegetationsökologe. Er setzt sich für das Ziel „Leben an Land“ ein und hat uns ein paar Fragen beantwortet.
Welchen Bezug hat Ihre Arbeit zu diesem SDG?
Wir beschäftigen uns seit ca. 40 Jahren mit Flora und Vegetation. Warum? Pflanzen sind die Primärproduzenten in der globalen Nahrungskette. Die Pflanzendecke ist bezüglich ihrer positiven Auswirkungen für das Leben am Land kaum zu überschätzen: Nahrung, Energieträger und Baustoff, Viehfutter, Sauerstoffproduzent und CO2-sink, Erosionsschutz, Schattenspender usw.
Welche Auswirkungen haben nun aber die globalen Umweltveränderungen auf die Pflanzendecke?
Während viele darüber reden, erforschen wir bereits seit Jahrzehnten die Auswirkungen von Global Change auf unterschiedlichen Skalenebenen, dies beginnt bei experimentellen Untersuchungen zur Populationsbiologie von Schlüsselarten bis hin zu Langzeitbeobachtungen über die Veränderung der Artenzusammensetzung von Pflanzengesellschaften der traditionellen Kulturlandschaften. Wie wirken sich Temperaturerhöhung, Ausbreitung gebietsfremder Pflanzenarten, Stickstoffeintrag, Fragmentierung oder Urbanisierung auf die Biodiversität bzw. Phytodiversität aus? Welchen Einfluss haben Nutzungsänderungen auf den Artenreichtum unserer Landschaft? Wie verlaufen Sukzessionen auf neuen, in der Natur nicht oder kaum vorkommenden Substraten? Wie erfolgt die Ausbreitung von Pflanzen entlang von Flüssen, Eisenbahnlinien und Autobahnen, also von sogenannten linearen Strukturen? Welchen Einfluss spielt der Faktor Zeit für Artenreichtum und Phytodiversität von Habitaten? Stichproben an ganz unterschiedlichen Ökosystemen wie alten Wäldern, mittelalterliche Burg- und Befestigungsanlagen archäologische Ausgrabungen zeigen den besonderen Wert des Alters von Standorten. Als einfache Modellsysteme untersuchen wir auch Äcker, Trockenrasen, Pionierwälder und salzbeeinflusste Habitate ebenso wie die Umgebung von Zierpflanzenbeeten, um die Ausbreitung von Neophyten bereits im status nascendi beobachten zu können. Gerade auch die Zusammenhänge zwischen Klimaerwärmung und zunehmender Ausbreitung von gebietsfremden Pflanzenarten sind wieder gern bearbeitete Themen von Examensarbeiten, wobei die Ergebnisse keineswegs immer eindeutig sind, oft spielen auch die sich schnell wechselnden Gartenmoden bei der Invasion von Pflanzen eine große Rolle. Regional fokussieren wir unsere Forschung auf Mitteleuropa, auf das Alpen-System, auf Südosteuropa, auf den Kaukasus sowie auf die Levante und Nordafrika. Damit können wir auch potenzielle „Klima“- und „Zukunftsbäume“ ebenso wie an prognostizierten Klimaänderungen angepasste Stauden kennenlernen und ihre Auswirkungen auf die Biodiversität abschätzen. Der Schwerpunkt unseres Interesses verschob sich mit der Zeit immer stärker auf die urbane Flora und Vegetation. In Mitteleuropa stellen Städte inzwischen die pflanzenartenreichsten Bereiche dar, für den regionalen Artenpool erlangen sie zunehmende Bedeutung, was wohl auch für unterschiedlichste Tiergruppen gilt. Hochspannend ist der Vergleich mit Städten in Nordafrika oder in Westasien, wo gezeigt werden konnte, dass die Wasserversorgung für die Vegetation in Städten für Pflanzen grundsätzlich besser ist als im Umland. Hier sind wir dann schon bei dem notwendigen Umbau unserer Städte wegen des urbanen Hitzeinseleffekts sowohl mit technischen Maßnahmen (Sonnensegel, Verwendung heller Anstriche, Entsiegelung der Bodenoberflächen, Cooling-Angebote mit Sprühnebeln) als auch mit biologischen Mitteln (Förderung spontaner Gehölzentwicklung wo immer es möglich ist; Straßenbäume, Entsiegelung von Gehwegen, Verzicht auf Verwendung von Herbiziden, Anlage von „coolen Parks“, Fassaden- und Dachbegrünung). Ein Screening von „Klimabäumen“ und “Zukunftsbäumen”, die dem Klimawandel hoffentlich besser gewachsen sind, wird von bereits verschiedenen Institutionen durchgeführt. Wir untersuchen die Auswirkungen auf ökosystemarer Ebene: Auswirkungen auf Mitbewerber, Verwilderung, Phytophagen etc.
Wie kamen Sie zu diesem Thema und woher kommt Ihr Interesse?
Tiere und vor allem Pflanzen faszinieren mich solange ich mich erinnern kann: So wurde in meiner Familie erzählt, dass ich bereits im Alter von drei Jahren die Blütenknospen einer Abutilon aufgedröselt hätte, weil ich wissen wollte, wie es in ihrem Inneren aussah. Damals war eine Abutilon eine teure Zierpflanze und man fürchtete für eine Weile einen missratenen Sohn zu haben. Trotzdem haben meine Eltern mein Interesse an Pflanzen und Tieren nach Kräften unterstützt. Mein Vater zeigte mir die Blutegel im Drömling, Flusskrebse im oberbayerischen Inntal und ließ mich jede Katze streicheln, die damals auf unseren Streifzügen nicht gerade wenige waren. Ich hatte das Privileg, einen sehr guten Biologie- und Chemie-Unterricht auf dem Gymnasium zu bekommen und konnte eine Jahresarbeit über die Vegetation Osttirols anfertigen, für die ich in Wien mit dem Hörleinpreis des Verbandes Deutscher Biologen (VDB) ausgezeichnet wurde, was zu einem großen Motivationsschub führte. In einer Schüler-Arbeitsgemeinschaft wurde ich an die Kartierung der Flora herangeführt, so dass ich bereits vor dem Abitur an der Süd-Niedersachsen-Kartierung (Univ. Göttingen) sowie an der Mitteldeutschland-Kartierung (Univ. Halle) teilnehmen konnte. Die Göttinger Kartierungsleitung erreichte sogar, dass ich als Wehrdiensteistender wieder nach Braunschweig versetzt wurde, um die Geländearbeiten fortsetzen zu können. 1984 habe ich dann die Leitung der Regionalstelle 10b für die Floristische Kartierung übernommen. Eigentlich wollte ich Biochemie studieren, die damals aber erst von sehr wenigen Universitäten angeboten wurde. Auch ein paralleles Studium von Biologie und Chemie war nicht möglich, da beides seinerzeit Numerus-Clausus-Fächer waren und man sich für eines entscheiden musste. Daher habe ich dann Chemie als Hauptfach und Botanik als Nebenfach studiert. In den Semesterferien habe ich als studentische Hilfskraft bei Prof. Reinhold Tüxen, dem Doyen der Vegetationskunde in Mitteleuropa, gearbeitet und wurde von ihm in die Pflanzensoziologie eingeführt. Hier konnte ich bereits in sehr jungen Jahren ein internationales Netzwerk aufbauen, das bis heute funktioniert. Die damaligen Braunschweiger Botaniker haben meine Habilitation für Botanik sehr unterstützt, ab 1982 konnte ich sukzessive Lehrveranstaltungen anbieten und eine eigene Arbeitsgruppe aufbauen. Seitdem engagieren wir uns in der Biodiversitätsforschung.
Welche Unterstützung wünschen Sie sich, damit Sie ihr SDG in Zukunft noch effektiver in Lehre und Forschung einbringen können?
1. Stärkung der „Organismischen Biologie“ in Lehre und Forschung, um damit auch die drohende Erosion der Artenkenntnis aufzuhalten bzw. umzukehren. Schon jetzt finden viele Behörden wie freiberufliche Gutachter bundesweit keine Mitarbeiter mit ausreichenden Artenkenntnissen mehr. [Vgl. auch: BMBF (2019): Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt].
2. Hierzu sollte an unserer TU der Zugang für relevante Lehrveranstaltungen ebenso für „Citizen Scientists“ wie für interessierte Studierende gerade auch anderer Fächer erleichtert werden. Neben den im jeweiligen Studiengang verankerten LVAs sollen auch Impulsreferate zu wichtigen oder kontroversen Themen des SDG 15 in lockerer Folge angeboten werden.
3. Exkursionen stellen in diesem SDG z. B. für Biologen und Umweltwissenschaftler/Geoökologen eine sehr wichtige Lehrveranstaltung dar. Die Freiburger Geobotanikerin Otti Wilmanns hat dies bereits 1976 sehr prägnant formuliert: „Exkursionen können - auch wenn sie nur in Zivilisationslandschaften führen - eine Fülle von biologischen Erlebnissen vermitteln, die sich in ein theoretisches Begriffssystem der Ökologie einbauen lassen, und dazu Verbindungen zu anderen Teildisziplinen aufzeigen. Sie können damit auch die persönliche Beziehung zur Natur, die Fähigkeit zu unmittelbarer Beobachtung, zur logischen Kombination und Wunsch und Fähigkeit zu eigenem Einsatz für die Natur stärken.“ Sie stellen nach eigener Erfahrung als Student und nach mehr als 40 Jahren Exkursionstätigkeit eine Gelegenheit für den ungezwungenen, hierarchielosen Dialog zwischen Studierenden und Lehrenden dar, die nicht wenige Studierende für bestimmte Aspekte der Exkursion begeisterte und so die Grundlage für die eigene spätere Spezialisierung legte. Ich schlage kleine Spaziergänge (Mini-Exkursionen) auch für den Campus der TU vor: Auf ihnen sollen vor Ort die Grundlagen (Klimawandel, Globalisierung, Biodiversität, aber auch Neophyten und Verunkrautung) im Hinblick auf eine Optimierung des Campus aus ökologischer Sicht diskutiert werden. Hierzu gehört auch die Stärkung unseres Botanischen Gartens, der nicht nur eine wissenschaftliche Pflanzensammlung und eine Experimentierfläche, sondern auch eine Abkühlungsinsel und deswegen ein wichtiges Naherholungsgebiet in Braunschweig darstellt.
