
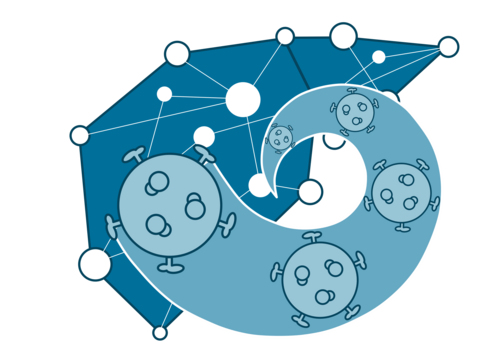
Die Behandlung von Infektionskrankheiten ist oft schwierig und insbesondere bei Virusinfektionen nicht immer zu 100% erfolgreich. Bei einer Untergruppe von Patienten können die Langzeitfolgen einer Virusinfektion trotz anfänglich erfolgreicher Behandlung fortbestehen. Die molekularen Mechanismen hinter solchen Langzeitfolgen sind bisher kaum bekannt.
Im Projekt NetfLID wird eine Plattform für die Datenintegration und -analyse entwickelt, die die Netzwerkmedizin und KI-Methoden nutzt, um die Mechanismen von Infektionskrankheiten auf verschiedenen Ebenen zu entschlüsseln, und zwar vom Epigenom und Transkriptom, bis hin zum Immuno-Proteom und Metabolom, sowie über die Zeit, d. h. über verschiedene Krankheitsstadien bis hin zur Nachsorge. Als konkreten Anwendungsfall für die Entwicklung dieser Plattform werden wir Hepatitis C untersuchen, eine Infektionskrankheit, die durch das Hepatitis-C-Virus (HCV) verursacht wird.
KI4ALL bündelt das KI-Wissen in unserer Region. Die drei Hochschulstandorte – TU Braunschweig, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und TU Clausthal – vernetzen sich untereinander und machen ihre gebündelte Expertise zugänglich. Zusammen mit dem Institut für Mathematische Optimierung, dem Institut für Nachrichtentechnik und dem Institut für Rechnergestützte Modellierung im Bauingenieurwesen haben wir an diesem Projekt mitgewirkt.
Das Projekt hat zum Ziel, fachspezifische sowie fachübergreifende Studien- und Lerninhalte zur Künstlichen Intelligenz besonders im Bereich des Maschinellen Lernens für Hochschulen zu entwickeln und deren Nutzung auch durch externe Stakeholder zu ermöglichen. Als dezentrale Plattform für diese Entwicklungsaktivitäten wird ein KI-Hub etabliert, der eine abgestimmte Entwicklungs- und Nutzungsplanung sowie die Implementierung innovativer Lern- und Vermittlungskonzepte ermöglicht und KI-basierte Innovationen fördert. Die Zielgruppen des KI-Hubs umfassen neben der Hauptgruppe der Studierenden auch die Lehrenden, Mitarbeitenden aus Technik und Verwaltung sowie die Hochschulexternen.
.
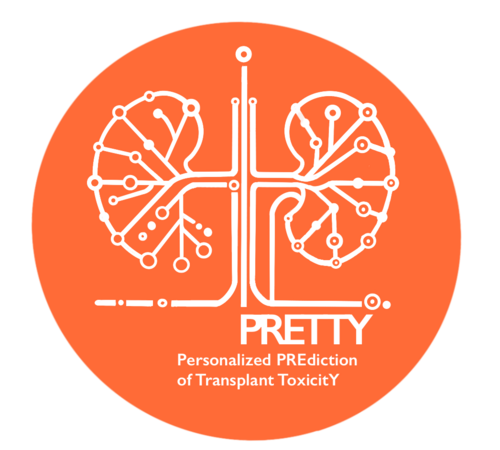
Leukämiepatient(inn)en, die sich einer allogenen hämatopoetischen Zelltransplantation (alloHZT) unterziehen, können als schwere Nebenwirkung an Nephrotoxizität leiden. Über die Risikofaktoren, die die Nephrotoxizität bei einzelnen Patienten begünstigen, ist nur sehr wenig bekannt. Die Haupthindernisse für den Erkenntnisgewinn sind das Fehlen einer umfassenden Datenerhebung und -analyse großer Patientenkohorten. Im Projekt werden diese Hindernisse adressiert, indem die prospektive Datenintegration
in den Datenintegrationszentren (DIZ) von vier großen Universitätskliniken ermöglicht, vier lokale personalisierte Vorhersagemodelle für Nephrotoxizität bei der alloHZT-Behandlung etabliert und die vier lokalen Modelle in ein einheitliches föderiertes Vorhersagemodell integriert werden. Der Hypothese nach wird dieser Ansatz die Vorhersagegenauigkeit verbessern. Im Gegensatz zu den meisten föderierten Lernansätzen, die sich auf Daten konzentrieren, wird hierbei auch lokales Fachwissen der Behandelnden (Arztperspektive) und der Behandelten (Patientenperspektive) in das Modelllernen integriert. Der Ansatz soll die Lebensqualität und das Überleben von Patient(inn)en, die sich einer alloHZT Behandlung unterziehen müssen, verbessern, modifizierbare Risikofaktoren für Nephrotoxizität identifizieren und so Krankenhausaufenthalte und Krankenhauskosten reduzieren.

Depressive Störungen stellen ein großes Gesundheitsproblem dar und gehören zu den am weitesten verbreiteten Erkrankungen in Europa. Trotz der Vielzahl verfügbarer Therapieverfahren, kann bislang nur ein Teil der Betroffenen erfolgreich behandelt werden. Obwohl es zahlreiche Hinweise für die Existenz von Untergruppen gibt, die besonders gut auf spezifische Therapieoptionen ansprechen, wurden noch keine etablierten Marker für diese Untergruppen identifiziert. Das Verbundprojekt P4D verfolgt verschiedene Ziele, um die Diagnostik, Therapie und Prävention depressiver Störungen durch personalisierte Behandlungsansätze zu verbessern. Dafür wird ein bereits identifizierter Blutmarker für das Ansprechen auf Antidepressiva klinisch überprüft und weiterhin eine große Kohorte von Patient(inn)en rekrutiert, um mittels maschinellen Lernens neue Subtypen der Depression zu erkennen. Weiterhin werden innovative Entscheidungshilfen für Behandler entwickelt und eine webbasierte Plattform etabliert, über die die gewonnen Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht werden können.
Der Einsatz von auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Methoden in den Lebenswissenschaften birgt enormes Potenzial, gleichzeitig aber auch erhebliche forschungsethische Herausforderungen mit gesellschaftlichen Implikationen. In der Wirkstoffforschung, bei synthetischen Daten, der Simulation von digitalen Zwillingen, der Erstellung polygenischer Risiko-Scores oder der Prädiktion von Gesundheitsrisiken versprechen datengetriebene KI-Methoden disruptive Effizienz- und Innovationssprünge. Neben den mittlerweile klassischen Herausforderungen der KI-Ethik reichen die damit verbunden ethischen Fragen angefangen bei Dual-Use-Problemen über den Individual- versus Gruppen-Nutzen, unabsehbare gesellschaftliche Langzeitrisiken bis hin zum sozialen Wert von Forschung. Um diesen komplexen Fragen zu begegnen, entwickeln wir gemeinsam mit dem Institut für Kommunikationswissenschaft der TU Braunschweig und dem Institut für Ethik, Geschichte und Philosophie der Medizin der MH Hannover ein analoges kooperatives Rollenspiel, das sich an Schülerinnen und Schüler sowie Studierende in den Lebenswissenschaften richtet. Ziele des Projekts sind, mit diesem Spiel den argumentativen Diskurs auf sachlicher Ebene zu fördern und gleichzeitig Raum für unterschiedliche ethische Positionen zu schaffen sowie über die Forschungspraxis der Lebenswissenschaften aufzuklären. Durch die spielerische Auseinandersetzung mit den ethischen Fragestellungen rund um KI-Methoden in den Lebenswissenschaften adressieren wir damit Sach-, Methoden- und Urteilskompetenzen. Begleitet werden die Spiele-Workshops mit eigens entwickelten Lehr- und Lernmaterialien. Die
Das aus Mitteln des Programms „zukunft.niedersachsen“ finanzierte Projekt beinhaltet die individuelle Prävention und Behandlung von Infektionen bei Patienten mit Leberzirrhose, der vierthäufigsten Todesursache in Europa. Zirrhose-Patienten leiden unter einer komplexen Störung des Immunsystems und haben ein siebenmal höheres Risiko, Infektionen zu entwickeln, was mit einer siebenfach erhöhten Mortalität verbunden ist. Eine rechtzeitige Diagnose sowie die sofortige Einleitung einer adäquaten Antibiotikabehandlung sind von entscheidender Bedeutung. Diese ist bei Patienten mit Leberzirrhose aufgrund des Auftretens multiresistenter Bakterien zunehmend schwieriger geworden, daher sind spezifischere, personalisierte Behandlungsschemata dringend erforderlich. Idealerweise sollten solche personalisierten Strategien das individuelle Infektionsrisiko berücksichtigen und direkt auf den zugrunde liegenden Erreger abzielen.
Ziel des Projekts sind deshalb die Identifizierung individueller Risikoprofile mittels multimodaler Datenintegration und der Entwicklung maßgeschneiderter KI-basierter Lösungen. Zudem sollen die aktuellen Diagnosetechniken zur Identifizierung und Charakterisierung der Erreger verbessert werden, um eine gezielte Behandlung auf der Grundlage der vorhergesagten Antibiotikaresistenz (AMR) zu ermöglichen. Dafür ist der Aufbau einer rechnergestützten OMICS- und Datenanalyse-Infrastruktur erforderlich, welcher die Möglichkeit bietet, neue Biomarker für die individualisierte Risikovorhersage und neue Ansatzpunkte für die Prävention und Behandlung von Infektionen zu identifizieren. Das Projekt wird Kliniken und Wissenschaftler aus drei verschiedenen Einrichtungen in Niedersachsen zusammenbringen und ein starkes Forschungsnetzwerk für die Weiterentwicklung personalisierter Behandlungskonzepte aufbauen.